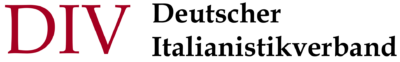Vortragsprogramm
1. Plenarvorträge
A. Patschovsky (Konstanz): “Konstanz und Italien im späten Mittelalter”
J. Albrecht (Heidelberg): “Probleme der italienischen Grammatikographie”
M. Picone (Zürich): “Autore/Narratore nella Commedia”
2. Literaturwissenschaftliche Sektion
2.1. Über die Schwierigkeiten, (s)ich zu sagen (Leitung: W. Wehle)
A. Kablitz (Köln): “Dantes Selbstverständnis”
K.W. Hempfer (Berlin): “Die Vorordnung des Diskurses vor das Subjekt: von Bembos Asolani bis Petrarcas Canzoniere”
W. Wehle (Eichstätt): “Et ‘ego’ in Arcadia”
P. Geyer (Köln): “Das Subjekt in der Bewußtseinskritik (Italo Svevo)
W. Helmich (Graz): “Ricordi d’una vita immaginaria. Autopoiesis im Erzählwerk Gesualdo Bufalinos”
H. Wetzel (Regensburg): “Münchhausens Zopf – Zanzottos Sprache über, vor, zwischen … Ich und Welt”
2.2. Stadt und Literatur (Leitung: P. Kuon / R. Zaiser)
A. Larcati (Salzburg): “‘La grande Mjilano tradizionale e futurista’. La scoperta della città nell’avanguardia futurista”
A. Grewe (Münster): “Stadt und Gedächtnis. Alberto Savinios Ascolto il tuo cuore, città”
P. Ihring (Frankfurt): “Stadt und Land bei Cesare Pavese”
T. Klinkert (Regensburg): “Sizilien als ‘città universale del genere umano’. Zu Elio Vittorinis Le città del mondo”
J. Heymann (Erlangen): “Stadtmodellierung als Sinnkonstituent in Giorgio Bassanis Erzählwerk”
S. Mex (Aachen): “Imaginierte Stadt-Körper: Italo Calvinos Le città invisibili”
D. Nelting (Aachen): “Inszenierung der Stadt bei Andrea De Carlo”
R. Stillers (Konstanz): “Mutmaßungen über eine Stadt: Zu Giorgio Manganellis Rumori e voci (1987)
3. Sprachwissenschaftliche Sektionen
3.1. Sprache und Stadt (Leitung: G. Held)
H. Goebl (Salzburg): “Das Hochitalienische – eine ‘Mega’-Stadt mit vielen zentralörtlichen Funktionen, oder: W. Christaller und die Dialektologie”
T. Stehl (Bremen): “Stadtsprache, Regionalsprache, geolinguistischer Raum: Wechselbeziehungen von Stadt und Land in Italien”
G. Bernhard (Regensburg): “Variation und Wandel in der Großstadt: Beispiel Rom”
G. Klein (Perugia): “‘Codice-nostro’ e ‘codice-loro’ nelle pratiche conversazionali di giovani Napoletani”
E. Radtke (Heidelberg): “Dialektale Innovationshemmung im Stadtdialekt: Eine diachrone Fallstudie zu Neapel”
J. Niehoff (Freiburg): “Sprachsituation in den italienisch/venezianisch beherrschten Städten der dalmatinischen Küste”
R. Franceschini (Basel): “I margini linguistici della città: la presenza dell’italiano in una città germanofona”
A. di Luzio (Konstanz): “Sulla ricostruzione degli spazi socioculturali e linguistici degli immigrati suditaliani nella città di Costanza”
3.2. Semantische und pragmatische Aspekte der italienischen Grammatik (Leitung: Chr. Schwarze)
K. Hölker (Konstanz): “Syntax und Semantik der italienischen Possessive: ein systemischer Zugang”
A. Blank (Berlin): “Entwurf einer kognitiven italienischen Wortbildung”
P. Koch (Tübingen): “Kognitive Aspekte der Motion: Zwischen Polysemie und Wortbildung im Italienischen”
F. Rainer (Wien): “Denominale Verben im Italienischen”
H. Siller-Runggaldier (Innsbruck): “Zur Semantik und Pragmatik von Verbpaaren des Typs ‘discutere qc’/discutere di qc.’, ‘pensare qc./pensare a qc.’, ‘fuggire qc./fuggire da qc.’ u.ä.
A. Stein (Stuttgart): “Polysemie- und Argumentationsstrukturen italienischer Verben”
P.M. Bertinetto (Pisa): “Distribuzione e uso di passato semplice e passato composto nelle lingue romanze, con particolare riferimento all’italiano”
U. Wandruszka (Klagenfurt): “Über die Bedeutung des italienischen Konjunktivs”